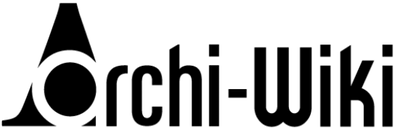Personne:Paul Hönle
De Archi-Wiki
| Métier | architecte |
|---|
Biographie
Il se qualifie très précisément de "Bautecknicker".
Nous supposons qu'il est allemand, peut-être de Kehl, mais sans garantie, ni d'ailleurs concernant l'orthographe exacte de son patronyme.